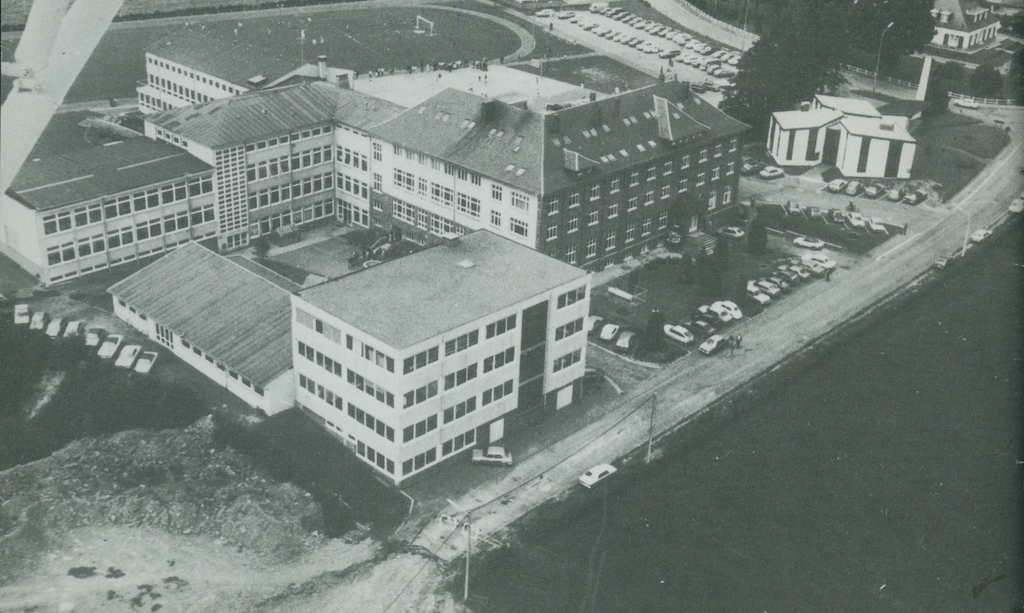Belgien hatte sich im Verlaufe des 19. Jahrhunderts sehr schnell zu einem unitaristischen Zentralstaat entwickelt. Nach 1945 war das nur noch ein Trugbild. Eine französischsprachige Oberschicht dominierte den Staat und die wallonische und französischsprachige Bevölkerung profitierte von ihrer Kenntnis der Staatssprache. Die flämische Mehrheit forderte mehr kulturelle und sprachliche Rechte. So wuchs der Widerstand gegen den Zentralstaat.
Das Land war deshalb seit den 1950er Jahren spürbar im Aufbruch. Ein Studienzentrum, benannt nach dem belgischen Politiker Pierre Harmel, wurde 1948 gegründet. Es erarbeitete bis 1955 einen Bericht über die nationalen Probleme, der 1958 verabschiedet wurde. Die Folge: 1962 wurden Sprachengrenzen per Gesetz und ein Jahr später der Sprachengebrauch im Unterrichtswesen festgelegt. Damit entstand auch ein offizielles deutsches Sprachgebiet in Belgien, das die heutigen neun deutschsprachigen Gemeinden umfasste. Von jetzt an konnte jeder Deutschsprachige theoretisch sein Recht einfordern, mit staatlichen Behörden in seiner Muttersprache kommunizieren zu dürfen. In der Praxis dauerte es allerdings viele Jahre, bis dieses Recht allgemein umgesetzt war. Gleichzeitig entstand hieraus ein neues Selbstbewusstsein in der Minderheit für ihre Rechte im Staat.
Die heutigen Großgemeinden Malmedy und Weismes gehörten ab diesem Moment zum französischen Sprachgebiet. Die Entscheidung über die Zugehörigkeit trafen die jeweiligen Gemeinderäte. In der Gemeinde Kelmis fiel diese Entscheidung knapp, mit nur einer Stimme Mehrheit zu Gunsten des deutschen Sprachgebietes aus.
Doch die Sprachengesetze waren nur ein erster Schritt. Die Flämische Bewegung forderte nicht nur sprachliche Rechte im Unterricht, in der Verwaltung und vor Gericht, sondern auch mehr politische Mitsprache. Sie sahen sich benachteiligt. Nur die ostbelgischen Studenten im flämischen Löwen erlebten die großen Spannungen zwischen Französischsprachigen und Flamen hautnah mit. In den Ostkantonen wurden die heftigen innerbelgischen Spannungen in den 1960er Jahren kaum registriert oder in der Presse beschrieben. Diese Autonomiediskussionen überwältigten zum Teil die im Laufe der Geschichte hin und hergerissene Minderheit, die sich ab Ende der 1960er Jahre positionieren musste.
Den Historikern stellen sich Fragen: Haben die Deutschsprachigen ihre Autonomie wirklich erkämpft? Oder ist sie das Nebenprodukt der Spannungen zwischen den beiden großen ‚Volksgruppen‘ von Flamen und Wallonen? Welche Interessensgruppen haben das demokratische Miteinander mit welchen Zielen bestimmt?
Ein Rückblick:
- Die zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs waren von einer starken Entpolitisierung des öffentlichen Lebens in Ostbelgien geprägt. Symptomatisch für diese Entpolitisierung war das geflügelte Wort, dass ein Ostbelgier nicht einmal mehr Mitglied im Herz-Jesu-Verein werden wolle. Dieses Verhalten war Teil des kollektiven Beschweigens.
- Die öffentliche Meinung wurde durch eine Zeitung mit Monopolstellung bestimmt, dem Grenz-Echo. Sie war das Sprachrohr der Christlich-Sozialen Partei (CSP). Diese bürgerlich-konservative Partei war im Brüsseler Parlament fast immer Teil der Regierungskoalition. Die CSP dominierte vor Ort das politische Leben: Zwischen 1946 und 1965 wählten zwischen 93 und 69 Prozent der Wahlberechtigten in Ostbelgien diese Partei. Die Christlich-Soziale Partei galt als die „Partei der Ostkantone“.
- Administrativ wurde die Region durch den beigeordneten Bezirkskommissar Henri Hoen zwischen dem 15. Januar 1945 und dem 1. Dezember 1976 verwaltet. Er versuchte bis in die 1960er Jahre die 1946 durch die belgische Regierung formulierten politischen Leitlinien umzusetzen: eine weitgehende Schließung der deutsch-belgischen Grenze und eine Orientierung der Deutschsprachigen zum Landesinnern, die Verbreitung eines belgischen Nationalismus und die Förderung der französischen Sprache in Verwaltung und Unterricht. Manche monierten, dass dies zum Nachteil der deutschen Sprache geschah, während andere Vorteile in einer Gesellschaft mit fortgeschrittenen Deutsch- und Französischkenntnissen sahen.
- Manche Ostbelgier hatten das Gefühl, dass ihnen wirtschaftliche Aufstiegschancen in Belgien verwehrt blieben. Die belgische Eifel war zudem strukturschwach. Arbeitsplätze gingen in der Landwirtschaft verloren. Alternative Arbeitsplätze waren unzureichend vorhanden. Die Abwanderung war hoch, und die wirtschaftliche Entwicklung auf einem sehr niedrigen Stand.
Die bisherigen Forschungsarbeiten verweisen auf Zäsuren und Wendepunkte in den 1960er Jahren: generationelle, weil jüngere Politiker eine neue Qualität in die Debatte einbrachten; soziale, weil gerade hier die Benachteiligung des ländlichen Raumes und der Minderheit besonders deutlich wurde; politische, weil die Dominanz der CSP so groß wurde, dass sie Gegenreaktionen förmlich provozierte.
Die kommunikative Erinnerung wird nach und nach durch ein kulturelles Gedächtnis ergänzt, in dem die gesellschaftlichen Traumata des Ersten und Zweiten Weltkriegs angerissen oder gar thematisiert werden:
- Neue Geschichtsvereine entstehen in Sankt Vith, Eupen und Kelmis.
- Junge deutsche und Schweizer Wissenschaftler arbeiten die Staatenwechsel von 1920 bis 1945 sowie die Zwischenkriegs- und Kriegszeit auf.
- Der Belgische Hörfunk (BHF) sendet eine Reihe zu „50 Jahre Ostbelgien“.
- Erste historiographische Arbeiten aus der Region erscheinen.
In den 1960er Jahren entstand eine langsame „Pluralisierung der Meinungsvielfalt“: Die Aachener Volkszeitung gab eine tägliche Ostbelgien-Beilage heraus (1965-1989); der Chefredakteur des Grenz-Echo Henri Michel wurde durch Heinrich Toussaint ersetzt, der andere Meinungen deutlich stärker zuließ; der Belgische Hörfunk, Sendungen in deutscher Sprache, baute sein Programm aus und trug zur Meinungsbildung bei.
Bis 1965 war die Christlich-Soziale Partei (CSP) das einzige Sprachrohr Ostbelgiens nach Brüssel. Die Nachkriegslethargie wurde im Wahlkampf von 1968 erstmals aufgebrochen. Die liberale Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) erhielt nach einem bemerkenswert modernen Wahlkampf ein Drittel der Stimmen. Die CSP erreichte nur noch knapp die absolute Mehrheit. Aus heutiger Sicht dürften viele Stimmen weniger ein Votum für die liberale Partei, als vielmehr ein Ausdruck eines gesellschaftlichen Protestes gewesen sein, den der nun kooptierte Senator Michel Louis (PFF) aus Sankt Vith nach Brüssel trug. Er setzte sich unerschrocken für die Anerkennung der Deutschsprachigen als Minderheit und für die Autonomie ein. Ostbelgien brachte sich aktiv und kontrovers in die Politik ein.
Der allgemeine Wertewandel veränderte Gesellschaft, Alltag und Mediennutzung. Neue Muster des Zusammenlebens entstanden, die durch die Demokratisierung des Unterrichts erheblich verstärkt wurden. Immer mehr Bürger wagten es, am politischen Leben teilzunehmen. Eine Repolitisierung des öffentlichen Lebens fand statt.
Als erste regionale politische Gruppierung entstand 1970 die Christlich-Unabhängige Wählergemeinschaft (CUW), die 1971 in der Partei der deutschsprachigen Belgier (PDB) aufging. Wortführer waren hier junge Politiker, die vor allem in Löwen die flämischen Visionen von Autonomie und Föderalismus kennengelernt hatten. Sie stellten in den Autonomiediskussionen Maximalforderungen. Ihnen standen die sogenannten traditionellen Parteien gegenüber. Eine Minderheit der bereits etablierten Politiker lehnte jede Umwandlung des belgischen Staates ab. Die Mehrheit in diesen Parteien beobachtete den Prozess eher mit Misstrauen. Sie setzten nach längerem Zögern auf eine Politik der kleinen Schritte im Bund mit ihren nationalen Mutterparteien. Ostbelgien sprach politisch mit vielen Stimmen.
In den belgischen Parteien hatte sich die Einsicht durchgesetzt, dass Belgien auf nationaler Ebene nur noch durch tiefgreifende Reformen zu retten sei. Eine kulturelle Autonomie der Sprachgemeinschaften sollte ein erster Schritt sein. So sollte der politische Druck der föderalistischen Flamen auf den Staat gemildert werden. Durch die erste Staatsreform (1970/1971) wurden die niederländische, französische und deutsche Kulturgemeinschaft gegründet.
Die Autonomie der deutschsprachigen Minderheit begann am 23. Oktober 1973 mit der Einsetzung des Rates der deutschen Kulturgemeinschaft. Dieser wurde 1974 als erster Kulturrat zum ersten Mal direkt und frei gewählt. Der flämische und französische Kulturrat wurden zwar schon 1971 eingesetzt. Doch erst die vierte Staatsreform von 1993 sah eine Direktwahl vor. Sie erfolgte erstmals im Jahr 1995. Der Brüsseler Regionalrat wurde seit seiner Schaffung 1989 direkt gewählt.
Der Rat der deutschen Kulturgemeinschaft verwaltete 1974 einen Haushalt von umgerechnet rund 300.000 Euro. Zudem verfügte er über wenige Befugnisse. Für die politisch interessierten Bürger war er aber das Symbol der lange erwarteten Anerkennung der deutschsprachigen Minderheit mit ihrer Sprache, Geschichte und Kultur. Als politisches Forum sollte er die Autonomiediskussionen und die Ausgestaltung des Autonomieprozesses maßgeblich in Eupen und Brüssel mitgestalten.
Im Jahr 1950 gab es für Ostbelgien unterschiedliche Zukunftsbilder: Eine Region, in der die französische Sprache in Schule, Verwaltung und Alltag dominierte. Oder eine Region, in der die deutsche Muttersprache und Kultur anerkannt wurde und Mitbestimmungsrechte möglich wurden.